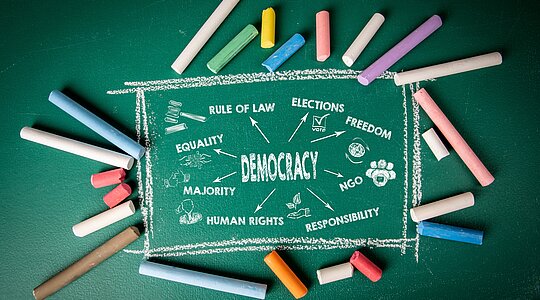JOURNALISTEN
Wir sind kein Klischee

Warum nur geraten Journalisten im Spielfilm so gnadenlos daneben? Weil die Drehbuchschreiber keine Ahnung vom Journalismus haben? Oder weil sich das Klischee besser verkauft als die Wirklichkeit?
Da hat sich einer richtig Mühe gemacht: Jan Freitag hat in der Süddeutschen Zeitung ein langes Stück über Journalistinnen und Journalisten im Spielfilm geschrieben. Auslöser war für ihn die ZDF-Serie "Neuer Wind im Alten Land", in der sich eine Starreporterin mit den Niederungen des Lokaljournalismus herumplagen muss. Das allein hätte schon eine ganze Zeitungsgeschichte füllen können, aber Freitag zog viele andere Beispiele fiktiver Journalisten von den "Unbestechlichen", gespielt von Robert Redford und Dustin Hoffman, bis zu Baby Schimmerlos heran und konnte so die Zusammenhänge zwischen Zeitgeist und Journalistendarstellung zeigen.
Ob es der Hollywood-Film über die Watergate-Affäre oder die vielen Veröffentlichungen der Washington Post und anderer Blätter über die kriminellen Machenschaften des damaligen US-Präsidenten Richard Nixon waren, die das Bild über die Reporter prägten, lässt sich nicht herausfinden. Auf jeden Fall führte die Watergate-Enthüllung zu dem Berufswunsch ganzer Generationen, "was mit Medien" machen zu wollen. Und auch wenn spätestens im journalistischen Praktikum klar wurde, dass nicht an jeder Straßenecke ein Nixon lauert und dass eine erregte Debatte im Kommunalparlament nicht zwangsläufig der für alle sichtbare Beleg eines handfesten Korruptionsskandals war, blieb die Aufdeckung von Missständen für die Generation der Babyboomer im Journalismus die entscheidende Motivation. Es sind die jüngeren Generationen, die das Beschreiben als wichtigstes Kriterium angeben, die aus Spaß an der Sprache in den Journalismus fnden.
Wird der Journalismus dadurch schlechter? Nein, er wird anders - und das muss nicht von Nachteil sein. Denn so wie sich die Gesellschaft verändert, muss auch der Journalismus beweglich bleiben - egal wie Spielfilme die Medienschaffenden darstellen.
Ein Kommentar von Hendrik Zörner