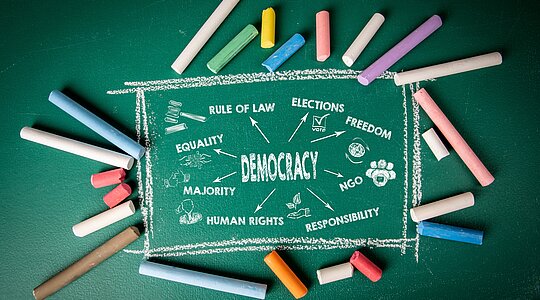Spiegel
Sonniges Gemüt
Der Machtkampf an der Spitze des Spiegel ist entschieden: Redakteur Dirk Kurbjuweit ist neuer Chefredakteur, Steffen Klusmann muss gehen. Klarheit ist gut, aber der Weg dahin war brutal.
"Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) erfüllt eine wichtige Aufgabe, ist manchmal aber etwas sonnig." So fängt der Bericht von Michael Hanfeld, Medienressortleiter bei der FAZ, über den Machtkampf beim Spiegel an. Deutschlands größte Journalistenorganisation mit sonnigem Gemüt? Sehr nett, gerade in Zeiten, da immer wieder konstruktiver Journalismus gefordert wird. Was Hanfeld tatsächlich meinte, kam dahinter: "und manchmal fordert er das Unmögliche". Mit "er" war wieder der DJV gemeint.
Er bezog sich auf die Pressemitteilung, die wir am Donnerstagmorgen herausbrachten, als die Schlagzeilen über eine mögliche Absetzung von Spiegel-Chefredakteur Steffen Klusmann überhand nahmen. "Spekulationen über einen möglichen unfreiwilligen Abgang von Chefredakteur Steffen Klusmann schaden dem Renommee des ,Spiegel‘ und können sich negativ auf die gute Entwicklung der Print- und Digitalabos auswirken", hieß es da. Es sollte nur noch einige Stunden dauern, bis Klarheit herrschte und Redakteur Dirk Kurbjuweit als neuer Spiegel-Chef ausgerufen wurde.
Ob Klusmann ein guter oder schlechter Chefredakteur war und Kurbjuweit jetzt alles besser macht, haben wir vom DJV nicht zu bewerten. Und genau deshalb war die Pressemitteilung vom 25. Mai auch keine Liebeserklärung an den da noch amtierenden Spiegel-Chef. Kritisierbar ist aber, wenn Personalfragen auf offener Bühne ausgetragen werden und die zahlenden Leser schlimmstenfalls den Eindruck bekommen, die Leute vom Spiegel seien mit sich selbst beschäftigt. Das ist nicht gut für den Spiegel und auch nicht für die Medien insgesamt. Deshalb ist es zu begrüßen, dass jetzt Klarheit herrscht.
Alles Gute und viel Erfolg, lieber Dirk Kurbjuweit. Laden Sie das "Sturmgeschütz der Demokratie", wie Ihr Vorgänger Rudolf Augstein den Spiegel taufte, mal wieder durch! Die Zeiten sind danach.
Ein Kommentar von Hendrik Zörner