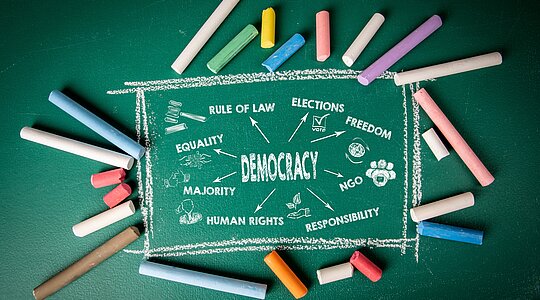Gerichtsberichterstattung
Campieren mit Justitia

Ob Justitia gern vor Gericht campieren würde? Bild: canva.com
Wer aus deutschen Gerichten berichten will, muss mitunter starke Nerven haben – und eine starke Blase. Stundenlanges Anstehen ohne Toiletten, Erkältungsgefahr oder das Übernachten auf der Straße sind in der Coronakrise für Gerichtsreporter*innen zum Alltag geworden. Das ist unwürdig für die Journalist*innen und für die Justiz.
"Ohne gute Gerichtsberichterstattung gibt es auch keine Akzeptanz des Rechtsstaats", sagt der Sprecher des großen Münchner Amtsgerichts, Klaus-Peter Jüngst der Süddeutschen Zeitung. Journalist*innen müssten ausführlich von Verfahren berichten können, sonst bröckle das Verständnis für den Rechtsstaat. Man lässt sie aber nicht, so fasst die SZ das Problem in ihrem Artikel vom 21. September knapp zusammen.
Schon beim NSU-Prozess ab 2013 tat sich das Münchner Oberlandesgericht durch seltsame Akkreditierungsregeln hervor: Die 50 verfügbaren festen Sitzplätze für Journalist*innen wurden im sogenannten „Windhundverfahren“ vergeben – wer sich zuerst meldete, bekam einen Platz. Erst nach heftiger Kritik und einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts änderte das Oberlandesgericht München die Vergabepraxis, um auch internationale Medien angemessen zu berücksichtigen. Die Plätze wurden dann per Losverfahren vergeben, was dazu führte, dass überregionale Medien wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung, der Stern, die tageszeitung, Die Welt und Die Zeit zuerst nicht berücksichtigt wurden.
Heute verweisen die Gerichte auf die Hygieneregeln im Kampf gegen die Coronapandemie und halten Plätze für Journalist*innen denkbar knapp. Beim Prozess zum Mord an Walter Lübcke vor dem Oberlandesgericht Frankfurt mit Auftakt im Juni 2020 hieß es "Die Sitzplätze werden nach der Reihenfolge Ihres Erscheinens vor dem Sitzungssaal vergeben (Schlangenprinzip)." Also warteten die Berichterstatter*innen nächtelang, um einen der viel zu wenigen Plätze im Gerichtssaal zu ergattern, bei unwürdigen Bedingungen – unter dem über dem Gerichtseingang in Stein gemeißelten Spruch „Die Würde des Menschen ist unantastbar“.
Die SZ berichtet, beim Audi-Prozess zur Diesel-Affäre übernachteten Journalist*innen mit Thermoskannen und Schlafsäcken oder sogar nur auf Zeitungen bei acht Grad Kälte. Ähnliches auch beim Prozess gegen den mutmaßlichen Amokfahrer von Trier. Wie der DJV erfahren hat, wird den Pressevertreter*innen dort zugemutet, ab 3 Uhr morgens vor dem Landgericht zu warten, um auch sicher in den Sitzungssaal zu kommen.
Gelernt haben daraus höchsten die Medienschaffenden, die Justiz anscheinend nicht. Teilweise werden Studierende dafür bezahlt, sich die Nächte damit um die Ohren zu schlagen, einen Platz in der Schlange freizuhalten. Man übt sich in Solidarität, Kolleg*innen des Bayerischen Rundfunks stellten beim Audi-Prozess sogar die Toilette in ihrem Übertragungswagen zur Verfügung. Ansonsten wäre nur das Gebüsch geblieben. Das Gericht zuckt nur mit den Schultern.
Es zeugt von Galgenhumor, wenn Max Hägler, Annette Ramelsberger und Jana Stegemann in der SZ schreiben „Journalisten sind es gewohnt, unter schwierigsten Bedingungen zu arbeiten. Geländegängig und anspruchslos, rund um die Uhr einsatzbereit und allzeit hellwach - das gehört quasi dazu. Doch die großen Verfahren in München legen seit Beginn der Corona-Pandemie neue Maßstäbe an ihre Leidensfähigkeit an."
Der Gesundheitsschutz in der Pandemie ist unverzichtbar. Eine funktionierende Berichterstattung unter menschenwürdigen Bedingungen aber auch. Die Justiz muss dafür sorgen, dass beides miteinander vereinbar ist. Dabei versagt sie gerade bei den großen Prozessen, die von hohem öffentlichen Interesse sind, auf ganzer Linie.
Ein Kommentar von Paul Eschenhagen