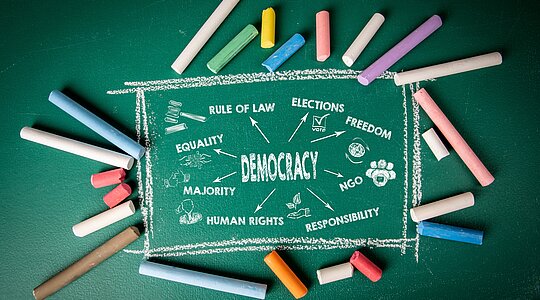Medienwandel
Aufbruch mit offenem Visier
Junge Journalisten sind die Hoffnungsträger einer Branche im Umbruch – doch sie müssen ihre Chancen in die eigene Hand nehmen.
Z w e i t a u s e n d d r e i z e h n war ein Jahr der „tipping points“ im Journalismus: Vielerorts wurden Weichen neu gestellt, Routen neu verhandelt, neue Projekte aufgegleist. Im Frühjahr machten gleich zwei Traditionszeitungen auf hochambivalente Weise von sich reden: Die „Frankfurter Rundschau“ vermeldete mit ihrer Insolvenz einen vermeintlichen Todeskampf, und die
„Westfälische Rundschau“ sollte sterben und doch weiterleben. Während die „Westfälische“ nur noch als Marke ohne Redaktion weiterexistierte, musste sich die „Frankfurter“ nach der Übernahme durch ihren einstigen Konkurrenten „FAZ“ gesundschrumpfen und entließ immerhin 30 bis 35 Prozent der redaktionellen Belegschaft. Dann zwei weitere Paukenschläge: Die Nachrichtenagentur dapd meldet im April Insolvenz an und verschwindet sang- und klanglos vom umkämpften Nachrichtenmarkt. In Hamburg wird die Doppelspitze des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ überraschend durch unterschiedliche Auffassungen über die Zukunft der Integration von Print- und Onlinestrategien freigestellt, der Nachfolger von den Redakteuren eher argwöhnisch begrüßt. Von Sommer bis Jahresende folgten weitere Branchenmeldungen mit großer Tragweite: Hubert Burda Media bringt die
„Huffington Post“ nach Deutschland; die Axel Springer AG gibt bekannt, einen Großteil ihres traditionellen Zeitungsgeschäfts verkaufen zu wollen; mit 49 Jahren übernimmt Jeff Bezos, Gründer und Chef des Welthandelsunternehmens Amazon, die Traditionszeitung „Washington Post“; die Mediengruppe Madsack versucht mit der Einrichtung einer Zentralredaktion für alle überregionalen (Mantel-)Teile von ihren 18 Regionalzeitungen und deren Digitalablegern, sich für die Zukunft zu wappnen; und kurz vor Weihnachten kündigt Ebay-Gründer Pierre Omidyar die Gründung eines hochkarätig mit Enthüllungsreportern besetzten Onlinemediums an, das den Mächtigen dieser Welt investigativ und aggressiv zu Leibe rücken soll.
Lehren aus dem jüngsten Transformationsschub
Die Liste an Branchenmeldungen, die vor wenigen Jahren noch jede für sich ein mittleres Beben ausgelöst hätte, ließe sich fortsetzen; denn Trends der vergangenen Jahre spitzten sich in jüngster Zeit zu, verdichten sich zeitlich und haben Konsequenzen für das, was wir unter Journalismus verstehen und wie und von wem er praktiziert wird. Die Transformation der Rahmenbedingungen, die journalistisches Arbeiten erst ermöglichen, es befördern, aber auch stören, ist in vollem Gange. Dass es sich bei den angesprochenen Ereignissen um mehr handelt als um übliche Marktbewegungen, fällt leicht ins Auge:Quintessenz 1: Aus betriebswirtschaftlicher Sicht sind journalistische Marken nicht ohne weiteres austauschbar, Journalisten aber offenbar schon. Die Scheinexistenz der „Westfälischen Rundschau“ und die personelle Radikalkur der mittlerweile wirtschaftlich wieder gefestigten „Frankfurter Rundschau“ schließen an die beispiellose Entlassungswelle aus dem Vorjahr an, als durch die Auflösung der „Financial Times Deutschland“ und der „Abendzeitung Nürnberg“, aber auch aufgrund von Einsparungen bei weiteren Verlagshäusern bereits Hunderte von Journalisten in die Arbeitslosigkeit geschickt wurden. Während die Marke der „Rundschau“ aus Dortmund nur noch bestückt mit Beiträgen anderer Zeitungen aus der Mediengruppe und lizenzierten Inhalten aus Fremdverlagen fortlebt, musste sich die „Rundschau“ aus Frankfurt redaktionell zumindest zahlenmäßig verkleinern, um geschäftlich wieder auf einen grünen Zweig zu kommen.
Quintessenz 2: Journalismus in Deutschland muss sich vermehrt auf Importkonzepte gefasst machen, die trotz unklarer Wirtschaftlichkeit und qualitativer Fragwürdigkeit mit Macht neue Formen der Aggregation, Produktion und Darstellung von Nachrichten verfolgen. Die „Huffington Post“ startete in Deutschland zwar ohne Vorschusslorbeeren, dafür wurde sie begleitet von einer Mischung aus Häme und Sorge. Grund dafür boten sowohl das Personalkonzept, das hauptsächlich darauf setzt, unbezahlte Autoren zu beschäftigen, als auch das redaktionelle Angebot, das zum Großteil aus aggregierten und umgearbeiteten Inhalten besteht.
Quintessenz 3: Traditionsreiche Verlagshäuser fühlen sich nicht zwingend an ihre Traditionen und an journalistische Marken gebunden, wenn geschäftliche Erwägungen in den Vordergrund treten. Die bis dato auflagenstärkste Verlagsgruppe in Deutschland, die Axel Springer AG, gab mit der Trennung von allen Zeitungs- und Zeitschriftentiteln mit Ausnahme der „Bild“ und der „Welt“ auch eine neue Schwerpunktsetzung bekannt, die das Kerngeschäft des Medienkonzerns betrifft: Innovative digitale Unternehmungen wie die App Runtastic oder umsatzstarke Geschäftsfelder wie die Touristikvermarktung haben das Interesse der Medienmanager geweckt. Andere deutsche Verlagsgruppen wie die Funke Mediengruppe oder die Mediengruppe Madsack setzen dagegen weniger auf Diversifikation, sondern auf eine verlegerische Expansion in die Breite durch die Übernahme von Zeitungs- und Zeitschriftentiteln bei gleichzeitiger starker Bündelung von Ressourcen wie der Einrichtung von Zentralredaktionen.
Quintessenz 4: Mit Mäzenen halten neue Akteure Einzug in den Journalismus, der vorrangig in den USA zunehmend als schützenswerte Kulturpraxis begriffen wird. Mit Jeff Bezos hat sich nicht nur ein Milliardär ein Sturmgeschütz der Demokratie gekauft (die „Washington Post“ enthüllte seinerzeit den Watergate-Skandal), sondern auch ein Pionier der New Economy und Profiteur des Digitalgeschäfts: Er hat sowohl die gesellschaftlichen als auch die ökonomischen Potenziale der publizistischen Weltmarke „Washington Post“ erkannt und ist offenbar bereit, Geduld und Geld zu investieren, um das Blatt crossmedial langfristig prosperieren zu lassen. Bezos ist nicht allein: E-Bay-Gründer Pierre Omidyar sorgte mit der Gründung von „The Intercept“, einem investigativen Onlineportal mit einem renommierten Redaktionsteam um den früheren „The Guardian“-Reporter Glenn Greenwald, weltweit für ein Aufhorchen in Medienkreisen. Eines ist beiden gemeinsam: Bezos und Omidyar investierten 250 Millionen US-Dollar in ihre journalistischen Unternehmungen – gemessen am Vermögen der Onlinemogule ein bescheidenes Startkapital.
Quintessenz 5: Die redaktionelle Kluft zwischen Print und Online ist noch nicht überwunden. Die Querelen über die Redaktionsspitze des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ und seiner erfolgreichen Onlinetochter lassen erahnen, dass die Unterscheidung zwischen gedrucktem und digitalem Journalismus vor allem ein Mentalitätsproblem der Redakteure selbst ist. Längst nimmt das Publikum journalistische Marken mediengattungsübergreifend wahr, doch die Redaktionskulturen folgen im Regelfall noch einem Zuständigkeits- und Hierarchiedenken, das die Dominanz der gedruckten Muttermarke betont. Online und Print nicht nur strategisch gemeinsam zu denken, sondern tatsächlich crossmedial zu praktizieren und auch personell eine Verschmelzung zu realisieren, ist eine der großen Herausforderungen des Journalismus, was nicht nur am Beispiel des „Spiegel“ beobachtet werden kann.
Die Vorzeichen für das journalistische Berufsfeld haben sich innerhalb weniger Jahre radikal verändert: Wer vor drei Jahren sein Bachelor-Studium begonnen hat und nun vor dem Abschluss steht, wird sich ob der ambivalenten Branchenstimmung eines mulmigen Gefühls nicht erwehren können. Wem soll man nur Glauben schenken? Während die sogenannten „digitalen Evangelisten“ (Hans Magnus Enzensberger) die unendlichen Möglichkeiten des Internets predigen, übt sich die Pressewirtschaft noch in Krisenbewältigung und leckt ihre Wunden. Einen Monat vor dem Weihnachtsfest 2012, am Ende eines erneut durchwachsenen Geschäftsjahres, bat bezeichnenderweise die einzige Traditionszeitung mit steigender Auflage Branchenvertreter um eine selbstkritische Einschätzung: „Was haben Sie und Ihr Haus in den vergangenen fünf Jahren falsch gemacht?“, fragte „Die Zeit“. Antworten gaben Julia Jäkel (Gruner und Jahr), Mathias Döpfner (Axel Springer), Dirk Ippen (Verlagsgruppe Ippen), Frank Schirrmacher („FAZ“), Ulrich Reitz („WAZ“) und einige mehr. Wenn es einen Konsens unter den Leuchttürmen des deutschen Journalismus und Medienmanagements gab, dann in der Haltung, die Kai Diekmann, Chefredakteur der „Bild“, formulierte: Guter Journalismus werde immer überleben. Was jedoch guter Journalismus sei und ob sich die Güte von Journalismus eher an Hergebrachtem oder auch an seiner Wandlungsfähigkeit ermessen lasse, fand unter den Befragten keine einheitliche Antwort.
Die Krise als Chance für den Nachwuchs
Die Nachrichtenbranche befindet sich am Ende einer Dekade, in der sich in der globalen Medienlandschaft vieles, auch vieles grundlegend verändert hat, inmitten eines Wandels, dem bisher nur ein eher hypothetischer Charakter beigemessen wurde und der gerade deshalb empfindliche Konsequenzen nach sich zog. Wolfgang Blau, Chefstratege für Digitales bei der britischen Zeitung „The Guardian“ und vormals Redaktionsleiter von „Zeit Online“, spricht von einer durch intensiven Branchendiskurs institutionalisierten kollektiven Angst. Und diese Angst habe dadurch an Intensität gewonnen, dass auch nach Jahren der Krisensymptome und ökonomischen Abwärtstrends keine verlässliche Aussicht auf eine Absicherung der etablierten Strukturen und Existenzen bestehe. Viel eher mehrten sich die Hinweise, dass es sich um eine permanente Revolution, einen unablässigen Strukturwandel handele.Vor diesem Hintergrund hat der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) Ende 2013 acht Thesen zur Zukunft des Journalismus zur Diskussion gestellt, die auch aufzeigen, wie Nachwuchsjournalisten ihre Chancen in der vermeintlichen Krise nutzen können:
1. Die Mehrheit der Journalistinnen und Journalisten arbeitet freiberuflich: Wer heute in den Beruf startet, muss in der Regel auf eigenen Beinen stehen und sich selbst vermarkten. Das war vor einigen Jahren noch anders,
als große Verlagshäuser noch als Felsen in der Brandung galten. Wer sich frühzeitig darauf einstellt, sich als Journalist selbstständig zu positionieren, ist im Vorteil.
2. Festangestellte werden zu Redaktionsmanagern: Für klassische journalistische Jobprofile werden Nachwuchsredakteure dieser Tage selten gesucht. Eingestellt werden junge vernetzte Spezialisten und digitale Alleskönner: mobile Journalisten (MoJo/MoJane), Community-Manager, App-Entwickler – Durchstarter mit Start-up-Mentalität, die das aufkeimende Change Management der Medienunternehmen voranbringen.
3. Journalistinnen und Journalisten werden zunehmend als Marke wahrgenommen: Wer als Journalist bei Facebook Freunde, bei Twitter Follower oder bei Flickr Kontakte an sich bindet, wird zusehends zum personalisierten Massenmedium und ist gehalten, seine Marke zu pflegen und seine Reichweite zu erhöhen. Selbstvermarktung und virales Expertentum sind neue Kompetenzen, die auch für Journalisten wichtiger werden. Das steigert auch ihre Attraktivität für Headhunter.
4. Digitale Kompetenz ist eine wichtige Bedingung für Erfolg: Mussten sich Thirty- und Fourtysomethings das vernetzte Arbeiten erst mühsam beibringen, sind die heutigen Be- rufsanfänger mit und in der digitalen Wirklichkeit à la YouTube, Instagram und WhatsApp aufgewachsen. Sie fremdeln mit der Redaktion als privilegiertem Elfenbeinturm, für sie ist mobiles, vernetztes und dialogisches Kommunizieren im Netz Lebensalltag, das Prinzip des Teilens von Inhalten natürlicher als das des simplen Vertriebs.
5. Journalistin/Journalist ist die-/derjenige, die/der verbindet und interagiert: Das Hauptbetätigungsfeld für Journalisten wird zunehmend das Social Web: Wer sich digitale Medientechnologien und Instrumente zur Interaktion und Bewältigung der wachsenden Flut von Inhalten wie u.v.a. Geofeedia, Rebelmouse, Storyful MultiSearch oder Topsy schnell aneignen und
in seine Arbeitsroutinen einbinden kann, gehört zu den Pionieren bei der Optimierung journalistischer Vermittlung von Informationen, ohne den Draht zum Publikum zu verlieren.
6. Journalistinnen und Journalisten werden zu Unternehmern: Existenzgründung ist im Journalismus kein Fremdwort mehr – innovative Konzepte für digitalen Journalismus und dazugehörige Dienste werden zum wichtigen Wirtschaftsfaktor und wecken das Interesse der institutionellen Platzhirsche. Wer sich als freier oder auch fest angestellter Journalist keine Gedanken darüber macht, wie Journalismus seinen öffentlichen Einfluss stärken und dadurch auch wirtschaftlich erfolgreich sein kann, überlässt sein Schicksal im Zweifelsfall den falschen Kräften.
7. Journalistinnen und Journalisten haben Freiräume: Selbst in klassischen Zeitungsredaktionen hat die Präsenzpflicht häufig nicht mehr die oberste Priorität. Für relevant wird erachtet, dass Journalisten nah an ihrer jeweiligen Zielgruppe arbeiten und dafür Handlungsspielräume brauchen: Das Ergebnis zählt, und die vernetzte Digitalkommunikation macht es möglich. „Mobile“ ist nicht nur das Motto der Stunde für die Nutzung von journalistischen Inhalten, sondern auch für ihre Produktion und Veröffentlichung.
8. Solidarität prägt den Umgang: Journalismus ist in einer Link-Ökonomie (Jeff Jarvis) weniger von Einzelkämpfertum als vielmehr von Kooperation und Solidarität gekennzeichnet. Man verweist auf seine Quellen, man respektiert die Rechercheerfolge der Kollegen – und der Nutzer, und feiert sie sogar, indem man sie kuratierend zusammenstellt. Auf diese Weise werden die moralethischen Grundsätze und Regelstrukturen professioneller Berichterstattung nicht ausgehebelt, sondern gefestigt.
Zwar sind nutzergenerierte Inhalte in Deutschland noch kein Massenphänomen: Im Vergleich zu anderen mediatisierten Gesellschaften wie den USA produzieren in Deutschland noch vergleichsweise wenige Bürger Videos und laden sie bei YouTube hoch, veröffentlichen eigene Blogs oder twittern regelmäßig. Dagegen nutzen recht viele Deutsche soziale Netzwerke, allen voran Facebook. Deshalb gehören „social networks“ – 10 Jahre nach der Gründung von Facebook – auch mittlerweile zum festen Bestandteil der journalistischen Recherche und des Dialogs zwischen Journalisten und Nutzern. Anders verhält es sich mit neuen populären Diensten wie Tumblr, Pinterest, Vine usw., die zwar schnell hohe Nutzungszahlen verzeichnen, aber nur zögerlich von Journalisten für ihre Arbeit fruchtbar gemacht werden. Umso mehr erhoffen sich Verlage und Sender durch die Rekrutierung junger digitaler
Überflieger frische Impulse von einer Generation, die ihnen seit
Jahren Rätsel aufgibt.
Neue Konkurrenz aus dem „social web“
Dass die Zukunft des Journalismus im Netz liegt, ist zwar eineder wenigen Gewissheiten in dieser Zeit des Umbruchs. Doch wie sich Journalismus angesichts der neu erwachsenen Konkurrenz aus dem „social web“ und fehlender tragfähiger Finanzierungsmodelle verändern wird, ist ein steter Quell der Sorge. Mit der „Huffington Post“ (gegründet 2005) und „Buzzfeed“ (gegründet 2006) stiegen zwei Hybridmedien zu den meistgenutzten Nachrichtenportalen der USA auf. In Deutschland versuchen der deutsche Ableger der „HuffPo“ und der „Buzzfeed“-Klon Upcoming.de, es ihren erfolgreichen Vorbildern gleichzutun. Der hybride Charakter erklärt sich aus der Art und Weise, wie Inhalte auf den Portalen veröffentlicht werden: Sowohl professionelle Journalisten als auch Nutzer stellen Beiträge online. Insbesondere Nachwuchsjournalisten werden mit der hohen Reichweite angelockt, um kostenlos Beiträge zu verfassen und dadurch den sprichwörtlichen Fuß in die Tür des News-Business zu bekommen.
Die Folge ist eine im Vergleich zu klassischen Nachrichtenwebsites enorme Menge an Beiträgen: Über 1.000 erscheinen jeden Tag. Die Inhalte bestehen zu erheblichen Anteilen aus umgeschriebenen, rearrangierten oder kommentierten Beiträgen und Fundstücken (Texte, Fotos, Videos) aus Fremdquellen wie anderen Medien und dem „social web“. Befeuert werden diese Hybridmedien durch Social-Media-Aggregatoren wie „Reddit“, die nutzergenerierte Inhalte sortieren und diese von ihren Nutzern bewerten lassen. Gemessen an journalistischen Standards stehen sowohl die „Huffington Post“ als auch „Buzzfeed“ in der Kritik, es handele sich um oberflächlichen und substanzlosen Journalismus oder gar eine „Medienlandschaft mit Zuckerguss“, wie sie von Frank Schirrmacher („FAZ“) ausgemalt wurde. Dennoch ist das bruchstückhafte und auf emotionale bzw. emotionalisierte Inhalte ausgerichtete Nachrichtenangebot im „social web“ aufgrund seiner Popularität im Wettbewerb um die Zeit der Nutzer und das Budget der Werbewirtschaft ein mächtiger Konkurrenzfaktor, dem sich traditionelle Nachrichtenmedien stellen müssen.
Stiftungsjournalismus vor dem Durchbruch
Der Qualitätsjournalismus, also sorgfältig recherchierte, ausgewogene und kritische Berichterstattung, könnte demgegenüber auch in Deutschland in naher Zukunft vermehrt auf zivilgesellschaftliche Förderung angewiesen sein. In den USA engagieren sich verschiedene Stiftungen für die Unterstützung journalistischer Projekte und Ausbildungsprogramme zum Zwecke der Anschubfinanzierung und Qualitätssicherung. Jenseits des Atlantiks gibt es auch einige der größten und erfolgreichsten Non-Profit-Projekte im Journalismus, darunter das unabhängige Redaktionsbüro „ProPublica“ und das kalifornische „Center for Investigative Reporting“, die mit ihrer investigativen Berichterstattung bereits mehrfach für den Pulitzerpreis nominiert und zum Teil auch ausgezeichnet worden sind. Recherchejournalismus wird hier unter intensiver Partizipation interessierter Internetnutzer praktiziert, die über die Websites der Organisationen oder soziale Netzwerkplattformen projektspezifisch zur Beteiligung aufgerufen werden. Hier wird Journalismus weniger als Produkt im ausdifferenzierten Angebotsportfolio von Medienunternehmen verstanden, sondern als Kulturpraxis beworben, an der die Bevölkerung teilhaben kann und sollte. Neue Konzepte für die Einbindung von Bürgern verfolgen zahlreiche Non-Profit-Projekte, die von der John S. and James L. Knight Foundation gefördert werden. Die Stiftung hat es sich zum Ziel gesetzt, die Grenzen des Journalismus neu zu verhandeln, um damit auf den aktuellen Strukturwandel der Öffentlichkeit zu reagieren. Die Knight Foundation gehört zu den wichtigsten institutionellen Förderern von Journalismusprojekten in den USA. Gleichsam betont die Stiftung das Streben nach journalistischer Exzellenz, um einer konzeptuellen Beliebigkeit und Zerfaserung des Berufsfeldes entgegenzuwirken. Auf diese Weise konnten gemeinnützige Projekte zu internationalen Erfolgsgeschichten aufgebaut werden (u. a. Spot.Us, Ushahidi, Freedom Fone). So fand auch das Crowdfunding, die Finanzierung von Journalismus durch viele Kleinspenden, international Verbreitung. Außerdem wurde eine Vielzahl neuer Techniken und Konzepte gefördert, die Journalisten dabei helfen, Inhalte auf innovative Weise zu vermitteln. Für Journalisten sind solche Förderstrukturen offensichtlich wie Oasen im Vergleich zu den widrigen Arbeitsbedingungen bei traditionellen Massenmedien. Zuletzt wechselte der hochdotierte „New York Times“-Kolumnist und frühere Chefredakteur Bill Keller zu einer solchen gemeinnützigen Journalismusinitiative: „The Marshall Project“ wird sich kritisch mit dem Justizsystem auseinandersetzen und rechnet mit themenspezifischer Stiftungsförderung. Damit übernehmen Stiftungen zu einem nicht unwesentlichen Teil eine Aufgabe, welche zumindest in den USA von vielen Medienunternehmen als institutionellen Trägern von Redaktionen immer schlechter wahrgenommen wird: Investitionsbereitschaft und Durchhaltevermögen. Erfolg wird im „Stiftungsjournalismus“ nicht in Nutzungszahlen oder Erlösen gemessen, sondern in jedem Einzelfall mittels qualitativer Kriterien, ob das Projekt sein (hochgestecktes) Ziel erreichen konnte, beispielsweise eine Plattform oder Technologie zu realisieren, über die Journalisten und die Bevölkerung besser und näher in Kontakt treten und ins Gespräch kommen können. Die Aktivität von Stiftungen hat bereits zu einer signifikanten strukturellen Veränderung geführt: Im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts haben mehrere sogenannte „Medialabs“ ihre Arbeit aufgenommen, mit Stiftungsgeldern finanziert und zumeist angesiedelt an Hochschulen. Diese Art Labore sind in unterschiedlichen Ausprägungen auf die experimentelle Entwicklung und Erprobung von Medieninnovationen für den Journalismus sowie auf den dazugehörigen Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis ausgerichtet. In Deutschland entdecken ebenfalls immer mehr Stiftungen die Förderwürdigkeit des Journalismus und unterstützen einzelne Journalisten mit Stipendien oder gemeinnützige Projekte. In Nordrhein-Westfalen soll mittelfristig eine „Stiftung für Vielfalt und Partizipation“ gegründet und von der Landesanstalt für Medien (LfM) in Düsseldorf verwaltet werden, mit dem Kernziel, Lokaljournalismus zu fördern. Die Gretchenfrage, wie Vertriebserlöse dauerhaft auf ein Wachstumsniveau gehoben werden können, so dass eine Absicherung der bestehenden Strukturen möglich erscheint, ist aber weder in den USA noch hierzulande beantwortet. Philanthropie fungiert in erster Linie als Stimulus, nicht als strukturelles Substitut. Dank der Förderinitiativen steht jedoch auch Medienunternehmen ein umfassendes Rüstzeug zur Verfügung, um sich auf die Stärken des eigenen redaktionellen Angebots zu besinnen. Die (Rück-)Gewinnung der Loyalität der Nutzer zum Journalismus ist insofern nicht allein ein unternehmerisches Ziel, sondern ein demokratietheoretisch relevantes Anliegen, das Stiftungen mit ihrer satzungsgemäßen Verpflichtung zum Dienst an der Öffentlichkeit auf den Plan rief.Rüstzeug für die digitale Zukunft
Viele alte Regeln, Routinen und Gewohnheiten halten sich ungeachtet des grundlegenden Wandels der Medienwelt bis heute renitent in den Redaktionen. Studien haben gezeigt, dass sich in Redaktionen weltweit individuelle Handlungsmuster als besonders stabil erweisen, was sich auch in einem zurückhaltenden Einsatz neuer Medientechnologien bei der journalistischen Arbeit ausdrückt. Auch deshalb suchen Medienunternehmen händeringend nach digital versierten Nachwuchskräften: Sie bringen das nötige Rüstzeug mit, um die Redaktionen in die digitale Moderne zu führen. Das wichtigste Innovationsmoment im Journalismus ist daher die Frage, wie sich Journalismus in den gegebenen Organisationsstrukturen, aber auch außerhalb von ihnen für die digitale Sphäre weiterentwickeln kann. Dabei geschieht in folgenden Innovationsbereichen zurzeit besonders viel:Management: unter anderem Geschäftsmodelle (z. B. Paid Content, Diversifikation, Location Based Advertising); Kultivierung unternehmerischen Denkens in Redaktionen, Beteiligung an unternehmerischen Strategien – Journalisten werden auch im Redaktionskontext vermehrt dazu angehalten, unternehmerisch zu denken und strategisch die Vermarktung ihrer eigenen Tätigkeit im Blick haben, um ihr Schicksal – und Leistungsprofil – selbst zu gestalten.
Darstellungsformen: unter anderem Customizing, Automatisierung; Datenjournalismus/Visualisierung komplexer Daten; Interaktion: dialogorientierte Formate, digitales Storytelling, Interactive Documentaries oder Newsgames – Journalismus wird multimedialer, interaktiver, mobiler und dynamischer und fordert Journalisten eine höhere Technikkompetenz bei der Bedienung und beim kreativen Einsatz digitaler Instrumente ab.
Arbeitsprozesse: unter anderem digitale Recherchemethoden (z. B. Crowdsourcing, Social-Media-Recherche); verschiedene Konzepte offener, kollaborativer und flexibler Arbeitsprozesse: Liquid Journalism, Prozessjournalismus, Netzwerkjournalismus, konnektiver Journalismus oder einfach: partizipativer Journalismus – Leser können in unterschiedlichen Rollen und Funktionen Teil des journalistischen Prozesses werden, z. B. als Korrektiv, Informanten oder Publikationspartner.
Redaktionsorganisation: unter anderem Weiterentwicklung integrativer Konzepte (Zusammenarbeit zwischen Print und Online sowie mit Entwicklern und Gestaltern); gemeinsame Weiterbildung (z. B. crossmediale Workshops); Transparenz und Öffnung: z. B. Open Newsroom – Förderung der Zusammenarbeit durch Aufwertung des Projektmanagements zur gemeinsamen Umsetzung konkreter redaktioneller Vorhaben.
Institutionelle Kooperation: unter anderem mit Non-Profit-Projekten (Stiftungsprojekten, spendenfinanzierten Projekten, Stipendien) oder mit Hochschulen – institutionelle Kooperationen versprechen praktische Synergien und nachhaltige Impulse für Medienhäuser: Neben dem Austausch von Inhalten können Redaktionen von innovativen Ideen aus Forschung und Entwicklung, von Anregungen und Unterstützung bei der Erprobung von Geschäftsmodellen und Finanzierungskonzepten, von Kostenersparnissen durch Drittmittelfinanzierung projektbasierter Konzeptentwicklungen, von Durchhaltevermögen und Unabhängigkeit zur Erarbeitung langfristiger Strategien sowie von einer steten Verfügbarkeit und aktiven Einbindung motivierter Studierender profitieren, denen wiederum der Berufseinstieg erleichtert wird.
Insbesondere die Zusammenarbeit zwischen Praxis, Ausbildung und Wissenschaft ist ob der zu bewältigenden Transformationsprozesse naheliegend: Journalisten, Medienmanager und Wissenschaftler sind sich in dem Bemühen, Wandel greifbar und kalkulierbar zu machen, näher, als es die zumindest in Deutschland oftmals fehlenden Brücken zwischen Theorie und Praxis vermuten lassen. Es gilt auf beiden Seiten, Methoden zu finden, Wandel zu erfassen, Mechanismen zu verstehen, Risiken abzuwägen und damit auch den eigenen Standort neu zu bestimmen. Kooperationen speziell mit Hochschulen sind auch für die Schulung eines ethischen Problembewusstseins probat. Denn durch den gewachsenen Druck im Redaktionsalltag, durch neue Methoden der Recherche, durch die Einbindung von Nutzern in journalistische Routinen und durch innovative Darstellungsformen werden neue berufsethische Fragen aufgeworfen. Zudem bleiben zwei der größten Herausforderungen auch im digitalen Zeitalter bestehen: Journalismus gegen die Einflüsse von PR und Politik zu wappnen, die nach neuen Varianten der Absicherung verlangen und mittels Austausch von praktischem Erfahrungswissen und analytischen Erkenntnissen entwickelt werden können. Die Zukunft des Journalismus wird in entscheidender Weise davon abhängen, wie es Redaktionen gelingt, ihre Beziehung zu den netzaktiven Menschen, die man einst als Publikum bezeichnete, zu festigen oder sie erst aufzubauen. Auch wenn sich die Transformation der Redaktionskultur mehr schleichend als radikal fortsetzen wird, gibt es keinen Weg zurück: Für den Journalismus ist das Jahrhundert der Stabilität vorbei. Journalisten können davon profitieren, genau hinzuhören, was die Nutzer, aber auch die eigenen Nachwuchskräfte bewegt, den Kontakt zu suchen, ihre Wechselwirkungen mit den Nutzern zu reflektieren und daraus zu lernen. Je mehr sich die lange als sicher geglaubten Rahmen lösen, desto weniger sind Krisenmanager gefordert, die kitten, was sich lockert, sondern Change-Manager: journalistisch kundige Führungskräfte, die Offenheit mit Versiertheit verbinden, um auf der Basis gründlicher Beobachtung des Mediengeschehens und sozialer Phänomene sowie mit Feinfühligkeit für die Anliegen der eigenen Belegschaft richtungsweisende Vorwärtsbewegungen anzustoßen, ohne dabei die Prinzipien des Journalismus zu verraten.
D r . L e i f K r a m p ist Forschungskoordinator am Zentrum für Medien-, Kommunikations- und Informationsforschung (ZeMkI) der Universität Bremen und Autor mehrerer Sach- und Fachbücher zu den Themen Medien und Journalismus. Demnächst erscheint der gemeinsam mit Stephan Weichert und Martin Welker verfasste Band „Die Zeitungsmacher: Aufbruch in die digitale Moderne“ im Wiesbadener Verlag Springer VS. kramp@uni-bremen.deDieser Beitrag wurde zuerst im Magazin des Frankfurter Presseclubs / Ausgabe 2014 veröffentlicht.